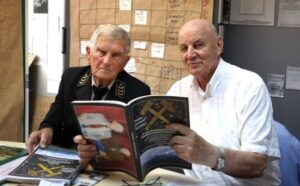Luisa Zenker und Florian Reinke
Dresden. Sachsens Wirtschaft sorgt sich um einen verstärkten Fachkräftemangel, weil die Bundesregierung ab 2026 einen neuen Wehrdienst einführen will. Dieser soll zwar freiwillig sein, ist aber an einen verpflichtenden Fragebogen für junge Männer ab dem Jahrgang 2008 geknüpft.
Der Wehrdienst dürfe nicht zum „massiven Eingriff in den Arbeits- und Fachkräftemarkt führen“, mahnt Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Dresden. Die Grundausbildung solle so kurz wie möglich gehalten werden. Bereits jetzt werde jede Fachkraft in den Betrieben händeringend benötigt. So verzeichnet das sächsische Handwerk 84 offene Stellen auf je 1000 Beschäftigte.
Handwerkskammer Leipzig: Entscheidungen mit Augenmaß
Der Hauptgeschäftsführer der HWK zu Leipzig, Volker Lux, mahnt zu „Entscheidungen mit Augenmaß“, die eine Balance zwischen Verteidigungsfähigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit herstellen. Die Teilhabe der regionalen Wirtschaft an den zusätzlichen Geldern aus den Sondervermögen sei ausdrücklich erwünscht. Eine Wehr- oder Dienstpflicht stehe diesem Ziel aber entgegen.
Auch der Bausektor sorgt sich, dass sich der Fachkräftemangel verschärft. Die Branche verzeichnet jetzt schon 90 offene Stellen auf 1000 Beschäftigte. Die Bauwirtschaft stehe gleichzeitig unter konjunkturellem Druck, betont der Bauindustrieverband Ost. Dennoch sei dem Verband bewusst, dass Wehrfähigkeit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei. „Beide Herausforderungen müssen daher klug miteinander vereinbart werden, anstatt sie gegeneinander auszuspielen“, sagt Hauptgeschäftsführer Robert Momberg.
Bausektor: Sorge vor verschärftem Fachkräftemangel
Der Wehrdienst solle den jungen Menschen auch zur beruflichen Orientierung dienen, äußern die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Sachsen, etwa durch einen Zuschuss zur Fahrerlaubnis. Der Dresdner IHK-Geschäftsführer Lars Fiehler fordert, dass der Wehrdienst erst nach der Ausbildung absolviert wird und diese „auf keinen Fall unterbrechen“ darf.
Problematischer dürfte sein, dass der Wehrsold selbst für Grundwehrdienstleistende auf 2000 Euro festgesetzt werden soll. – Joachim Ragnitz, Leiter des ifo-Instituts in Dresden
Nach mehreren Angaben braucht die Bundeswehr rund 80.000 zusätzliche Soldaten. Anfänglich sollen 5000 Personen den neuen Wehrdienst ableisten, 2031 dann rund 31.000 Personen. Zum Vergleich: 350.000 wehrpflichtige Männer gibt es pro Jahrgang. Ökonom Joachim Ragnitz hält deshalb die Folgen für den Arbeitsmarkt für gering.
Wehrdienst vermittelt Disziplin und Teamarbeit
„Problematischer dürfte sein, dass der Wehrsold selbst für Grundwehrdienstleistende auf 2000 Euro festgesetzt werden soll“, so der Leiter des ifo-Instituts in Dresden. Das könne junge Menschen dazu bewegen, sich längere Zeit bei der Bundeswehr zu verpflichten. Wenn diese allerdings eine Ausbildung bei der Bundeswehr absolvieren, kann davon das Handwerk später profitieren, weil es Ausbildungskosten spart.
Zudem werden durch den Wehrdienst „wichtige Fähigkeiten wie Teamarbeit und Disziplin vermittelt, die auch auf dem Arbeitsmarkt entlohnt werden“, bilanziert eine DIW-Studie.
Freiwilliges Jahr im Handwerk: Vier Berufe in einem Jahr
Um die Suche nach Azubis zu erleichtern, wollen die Grünen ein freiwilliges Jahr im Handwerk zum Ausbildungsjahr 2026 einführen. „Wer sich im Betrieb bewährt und wohlfühlt, steigt oft auch als Azubi ein – aus Überzeugung und Leidenschaft“, sagt die sächsische Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert (Grüne), die den Antrag im Landtag eingereicht hat. 120 junge Menschen könnten so drei bis zwölf Monate in verschiedene Handwerksberufe reinschnuppern. Die Aufwandsentschädigung würde je zur Hälfte vom Land und vom Betrieb getragen.
Die Idee stammt aus Schleswig-Holstein. Dort gibt es das Jahr seit Juni 2024. Die HWK Dresden begrüßt den Vorstoß. Man favorisiere aber immer den direkten Übergang von Schulabgängern in eine duale Ausbildung. Die SPD-Fraktion findet den Impuls „richtig“. Der Antrag greife aber zu kurz. Die CDU will sich darüber mit der HWK austauschen, wer die Kosten tragen soll und wie hoch der Bedarf ist.
SZ