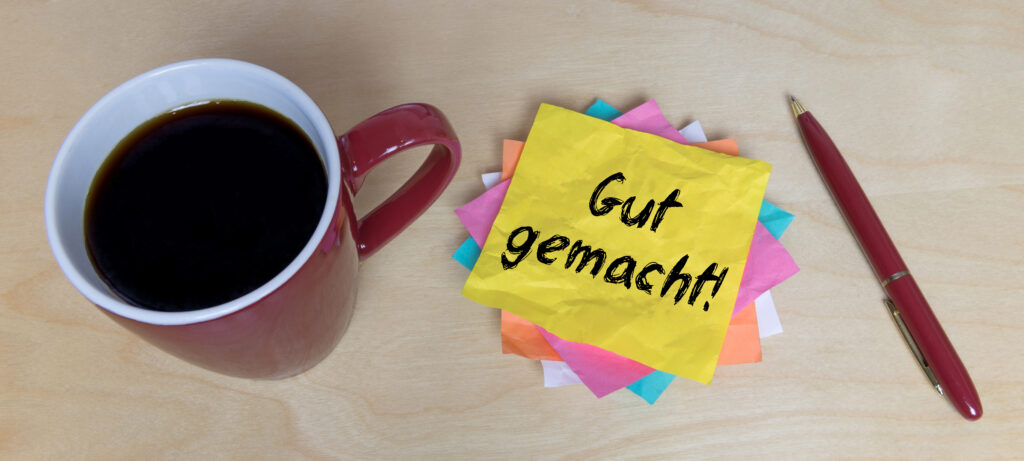Von Annett Kschieschan
Wieder eine Stunde länger im Büro geblieben, um noch schnell eine Kundenanfrage zu beantworten. Noch ein Projekt angenommen, weil der eigentlich zuständige Kollege krank geworden ist. Sich für die Fragen des Azubis Zeit genommen, obwohl der Terminkalender das nicht zulässt. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tun das und noch vieles mehr, um ihre Firma, die Kollegen zu unterstützen. Die berühmte Extra-Meile zu gehen, kostet allerdings Kraft. Gute Führungskräfte sehen das – und reagieren. Zum einen, indem sie verhindern, dass sich Mitarbeiter dauerhaft zu viel aufbürden, und zum anderen, indem sie Engagement deutlich wertschätzen.
Die drei Stufen zu einem wertschätzenden Miteinander
Aber wie funktioniert Wertschätzung im Arbeitsleben? Audris Alexander Muraitis vom Wittener Institut für Familienunternehmen (Wifu) und der psychologische Psychotherapheut Mirco Zwack haben dafür ein Drei-Stufen-Modell entwickelt. Die erste Stufe umfasst den allgemeinen, freundlichen Umgang im Unternehmen.
Das klingt selbstverständlich – ist es aber durchaus nicht überall. Jeden Mitarbeiter auf dem Flur zu grüßen, sich für eine Zuarbeit, und sei sie noch so klein, bedanken – all das umfasst die Grundlage wertschätzenden Verhaltens im Arbeitsleben. Auf der zweiten Stufe werde der Mitarbeiter in seiner Funktion wahrgenommen, heißt es im Drei-Stufen-Modell. Seine Leistung wird gewürdigt, Mehrarbeit als solche verstanden, Lob – und wenn nötig auch Kritik – werden konkret adressiert. Gesehen zu werden, da sind sich Arbeitspsychologen einig, ist die Basis für Wertschätzung.
Die dritte Stufe ist die hohe Kunst der Führung, denn sie erfordert Interesse, das über die reinen Arbeitsprozesse hinausgeht. Zu wissen, welcher Mitarbeiter nach einer Trennung gerade noch einen Umzug organisieren muss, wer einen pflegebedürftigen Angehörigen mitversorgt, wer einen besonders langen Arbeitsweg hat, macht es möglich, Beschäftigten dort entgegenzukommen, wo es ihnen wirklich hilft. Durch flexiblere Arbeitszeiten, mehr Möglichkeiten für Homeoffice-Tage oder einfach auch die ehrliche Frage nach dem Befinden. Empathie ist der Schlüssel zur Wertschätzung.
Worauf sind Mitarbeiter stolz – und wie sehen das die Kollegen?
Darüber hinaus gibt es wissenschaftlich basierte Übungen, die helfen können, Teams und Führungskräfte besser ins Gespräch miteinander zu bringen. Mary Shapiro, Professorin an der Simmons College School of Management in Boston und Autorin des HBR Guide to Leading Teams, empfiehlt, gemeinsam zu schauen, welche Kultur man im Team entwickeln und leben möchte. Und weil aller Anfang oft schwer ist, gibt es Modelle zur Unterstützung. Forscher der Universität Michigan haben etwa die „Reflected-best-self-Übung“ entwickelt. Dabei bitten Teammitgliedern ihre Kollegen, zu erzählen, wann sie etwas besonders gut gemacht haben. Anhand dieser Erzählungen könnten die Teilnehmer erkennen, welchen Einfluss sie auf andere hatten. „Es gibt den Menschen positive Verstärkung und Bestätigung“, sagt Mary Shapiro.
Warum auch Motivationstiefs zum Arbeitsleben gehören
Die Artefakt-Übung baut darauf auf. Hier werden die Teammitglieder gebeten, zu einer Besprechung zu kommen und über eine Leistung zu sprechen, auf die sie stolz sind – persönlich oder beruflich – und einen physischen Gegenstand zu präsentieren, der ihre Leistung repräsentiert, zum Beispiel ein Foto oder einen Alltagsgegenstand. Jeder Teilnehmer kann nicht nur seine Geschichte erzählen, sondern hört auch, was seine Kollegen erlebt und erreicht haben, worauf sie stolz sind. Das zeigt, dass jeder Fähigkeiten besitzt – oder Krisen gemeistert hat – von denen im Arbeitsalltags oft nichts spürbar ist.
Ein weiterer Tipp der Expertin sind sogenannte Gesprächskarten, die speziell für die Arbeitswelt entwickelt wurden. Die Karten enthalten in der Regel eine Reihe von Fragen, deren inhaltliche Bandbreite von „Was ist Ihr Lieblingsspiel und warum?“ oder „Was essen Sie gern?“ bis zu „Was würden Sie gerne an Ihrer Kindheit ändern?“ reicht. Die Karten sollen gerade in größeren Teamrunden helfen, das Eis zu brechen und jenseits täglicher Routinen miteinander ins Gespräch zu kommen.
Keine Frage: Das alles erfordert Zeit, die auch für Führungskräfte oft knapp bemessen ist. Experten sind sich jedoch einig, dass sich die Investition in ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern lohnt.
Manchmal wird aus hilfreicher Routine Langeweile
Das zeigt sich vor allem in schwierigen Zeiten. Die können externe Gründe haben, etwa rückläufige Aufträge oder eine schwierigere Marktlage, oder eher im persönlichen Bereich liegen.
Motivationstiefs sind im Arbeitsleben nicht selten. Oft haben sie mit den täglichen Routinen zu tun. Die sind grundsätzlich nichts Schlechtes. Sie geben Sicherheit, sind ein gutes Fundament für die stressigeren Phasen im Job. Ist aber der ganze Arbeitstag in immer gleiche Abläufe unterteilt, kann das auch für Langeweile und Frust sorgen. Aber das Gegenteil – ständig wechselnde Projekte, hohe Stressspitzen und viele spontane Termine – kann am Ende genauso zum Motivationskiller werden.
Wichtig sei es, ein gutes Maß zu finden, sagen Psychologen. Dieses Maß ist individuell und hängt von den persönlichen Bedürfnissen ab. „Wenn Sie immer nur darauf fixiert sind, das nächste Ziel zu erreichen, werden Sie Ihren Karriereweg immer nur als Belastung empfinden“, sagt etwa Christian Richter von der Beratungsplattform „Karriereservice“.
So sei der Spruch „Der Weg ist das Ziel“zwar im Kern richtig, wichtig sei es aber auch, bereits erreichte Ziele wertzuschätzen und das eigene Hamsterrad nicht pausenlos anzutreiben. Aber wie findet man nun den richtigen Weg, um motiviert zu bleiben, nicht stehen zu bleiben, aber auch nicht im Burn-out zu landen?
Teamplay ist keine Einbahnstraße
Ein Anfang kann ein ehrlicher Blick auf die eigenen Wünsche sein. Will man wirklich einen Führungsjob oder hat man nur das Gefühl, das Streben nach Verantwortung gehöre im Arbeitsleben nun mal dazu? Ist ein Beruf, bei dem man viel unterwegs ist, auch nach fünf Jahren noch aufregend oder nervt es irgendwann nur noch, große Teile des Lebens im Auto oder Zug zu verbringen? Stimmen die Eckpfeiler – also der Arbeitsinhalt, der Lohn, Arbeitsweg und -zeit – ist die Grundlage für eine gute Motivation gelegt. Intrinsische, also ganz persönliche Gründe, sind dabei genauso wichtig wie extrinsische Faktoren, bei denen ganz klar der Arbeitgeber am Zug ist. Zeigt dieser, was ihm gute Team- , aber auch Einzelarbeit wert ist, profitieren beide Seiten auf lange Sicht.
Mitarbeiter sind in der Regel ihrem Arbeitgeber gegenüber deutlich loyaler, wenn sie sich im Team und im Umgang mit dem jeweiligen Vorgesetzten wohl fühlen. Und ein Team, das auch in wirtschaftlich schwierigen Phasen bleibt, ist in Zeiten des Fachkräftemangels ganz besonders viel wert.