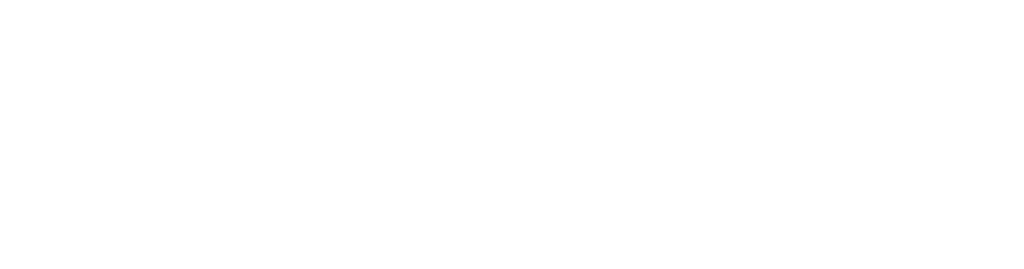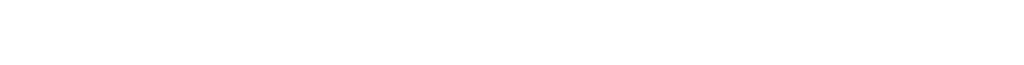Von Luisa Zenker
Rot, weiß, gelb reihen sich die Mehltüten im Ladenregal aneinander. So wie die Farben unterscheidet sich auch der Preis, der an jedem Kilogramm hängt. Zwischen 79 Cent und 2 Euro kostet das weiße Pulver, das seit Jahrtausenden zum Grundnahrungsmittel der Europäer gehört. Doch so unschuldig es mit seiner hellen Farbe wirkt, das Mehl trägt einen bitteren Beigeschmack. In ihm steckt der Zorn der Bauerndemos, die Anfang des Jahres das Land lahmlegten.
Auch der sächsische Landwirt Tobias Pelz ist Anfang des Jahres mit seinem Traktor protestieren gewesen. Er arbeitet in der Kornkammer Sachsens bei Lommatzsch. Dort gedeiht auf sanften grünen Hügeln das Getreide, das später in die Mehltüten verpackt wird. Das Agrarunternehmen bewirtschaftet 2.900 Hektar. Auf einem Drittel davon wächst nur Weizen. „Das macht 9.500 Tonnen“, sagt Pelz. Zum Vergleich: Jeder Deutsche verbraucht etwa 80 Kilogramm Getreide im Jahr.
Der studierte Landwirt ist einer von Tausenden Bauern, die in Deutschland nicht zufrieden sind. Ursachen dafür gibt es viele. Um eine davon zu zeigen, fährt Pelz zu zwei gelb angestrichenen Lagerhallen, die unscheinbar inmitten seiner Getreidefelder stehen.
Ein süßlicher Geruch strömt aus den dunklen Räumen, während er die graue Tür aufsperrt. Durch eine schmale Fensterreihe dringen ein paar Sonnenstrahlen herein, die sich Richtung Hallenmitte strecken. Dort ragt ein gelbbrauner Haufen bis ans Dach. Er erinnert an eine Sanddüne. Es handelt sich um den Weizen, den Pelz vor einem halben Jahr geerntet hat. Er nimmt ein paar Körner in die Hand und lässt sie wie feinen Sand durch seine Finger rieseln. Ein paar behält er in seinen Händen, nimmt sie in den Mund und kaut darauf herum. „Das schmeckt wie Zucker.“ So süß das Getreide auch ist, haben will es kaum jemand. Mehr als eine Million Euro sei die Menge vor ihm wert. Zehn Meter weiter gibt es noch eine prall gefüllte Halle.

Der Weizen zwischen Nah und Fern
Der Bauer lagert wie die meisten Landwirte einen Teil seines Getreides über den Winter ein, weil im Frühjahr der Preis nach oben geht. Doch in diesem Jahr ist es anders. Das Lager ist voller als normalerweise. „Zu diesem Preis verkaufe ich nicht“, sagt der Landwirt und blickt auf ein Dokument: Börsenpreise für Getreide reihen sich dort aneinander. Von ihnen ist der Bauer abhängig. „Es ist wie ein Lottospiel.“ Täglich ist sein Blick auf die europäische Weizenbörse gerichtet. Dort beobachtet er genau, zu welchem Preis er das Getreide loswerden darf.
Zurzeit liegt der Börsenpreis bei rund 200 Euro pro Tonne Weizen. Die Kurve bewegt sich seit Monaten abwärts. Dem Landwirt gräbt das tiefe Falten ins Gesicht, denn zu den Dumping-Preisen will er nicht verkaufen. Das sei nicht kostendeckend, weil die Ernte im vergangenen Jahr teurer gewesen sei. Die Zahlen an der europäischen Börse haben starke Schwankungen hinter sich: Während der Betrag für eine Tonne Getreide Anfang 2022 noch bei 260 Euro lag, verdoppelte er sich mit Ausbruch des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine schlagartig, weil die Handelshäfen am Schwarzen Meer blockiert wurden. Davon profitierten auch deutsche Bauern. Seit Herbst rast der Preis aber in die Tiefe.
Der Grund: die zollfreie Einfuhr von ukrainischem Getreide. So zumindest erklären es sich viele Landwirte, ebenso die Bauernverbände. Der Landesbauernverband spricht von einem Schaden in dreistelliger Millionenhöhe.
Seit dem russischen Angriffskrieg habe sich der globale Warenstrom des Weizens verändert, erläutert auch Getreideeinkäuferin Konstanze Fritzsch von der Dresdner Mühle. Zuvor lieferte die Ukraine einen Großteil des Weizens via Schiff über das Schwarze Meer nach Afrika und Asien. Mit Beginn des Krieges ist das nicht mehr möglich. Seitdem wird das Getreide per Lkw, Schiene und über mehrere polnische Zwischenlager auf dem Festland an die nordeuropäischen Häfen transportiert. Innerhalb von zwei Jahren hat sich die Einfuhr von ukrainischem Getreide laut Statistischem Bundesamt verdreifacht. „Es drückt auf bereits volle Lager“, sagt Fritzsch.

Das Problem für die heimischen Landwirte: Das Angebot übersteigt die Nachfrage. „In der Ukraine herrschen andere Produktionsbedingungen“, fügt Fritzsch hinzu: ein zum Teil höherer Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln sowie niedrigere Löhne. Doch nicht nur das Getreide aus der Ukraine sorge für den Preisverfall. Auch Ware aus Russland ströme auf die Märkte.
Die europäischen Bauern wollen das nicht hinnehmen. Mehrere Proteste gibt es deshalb an den osteuropäischen Grenzen. Autobahnen werden teilweise blockiert. Pelz ist das zu extrem. Unzufrieden ist er trotzdem. Die Europäische Union hat vor Kurzem entschieden, dass die Einfuhr von ukrainischem Getreide zollfrei bleibt. Der Bauernverband hingegen fordert eine Einschränkung. Der Getreidehändler Jes-Christian Hansen sieht das anders. Von einer Flut ukrainischer Agrarprodukte könne man nicht reden. Der Geschäftsführer ist verantwortlich für das Agro-Terminal in Heidenau Drentwede sowie die HaBeMa Futtermittel GmbH in Hamburg. Drei Millionen Tonnen Getreide laufen pro Jahr durch seine Hände in Hamburg. Bei Heidenau werden allein 700.000 Tonnen Weizen und Gerste aus Sachsen sowie Tschechien auf Züge verladen.
Während der Getreidehändler in Hamburg ein Schiff beobachtet, das Futterweizen nach Thailand belädt, sagt er am Telefon: „Sachsen hat eine grandiose Weizenkultur.“ Doch seit vergangenem Jahr sei das anders. Das trockene Frühjahr, die nassen Sommermonate haben dazu geführt, dass ein beachtlicher Anteil des Weizens eine schlechte Qualität habe und nur als Futtermittel gehandelt werden könne. Die Gründe dafür sind vielfältig und haben auch mit den politischen Rahmenbedingungen zu tun: „Die Kausalkette mit der Ukraine halte ich nicht zwingend für schlüssig.“
Auch die Dresdner Mühle sorgt sich um die Qualität des Weizens, weshalb der Großabnehmer Anfang des Jahres mit den Bauern protestierte. „Für uns als Mühle ist die Produktion hier vor Ort entscheidend“, erklärt Fritzsch die Unterstützung.
In der Dresdner Mühle landet ein Teil des Getreides von Landwirt Pelz und weiteren 200 Bauern aus der Region. In dem 1914 errichteten Gebäude wird das Getreidekorn gewaschen, gewalzt, gesiebt und wieder gewalzt. Über geschlossene Leitungen rieselt es in dröhnenden Mahlmaschinen Tag und Nacht 63 Meter von oben bis nach unten. In der ersten Etage wird das feine Pulver dann in die typischen Kathi-Tüten verpackt, insgesamt 200.000 Tonnen pro Jahr.

Die Macht des Einzelhandels
Von da aus wandern die Tüten zu den Bäckern und in die Regale von Edeka, Kaufland, Rewe und Konsum. „Lidl und Aldi machen zu hohen Preisdruck“, erklärt Fritzsch den Grund, warum es dort keine mitteldeutschen Kathi-Tüten gibt. Im Dresdner Konsum kommt das regionale Mehl 1,49 Euro. Zwei Regale tiefer kostet eine andere Mehltüte nur die Hälfte.
„Das kann aus ganz Europa kommen“, sagt Fritzsch und zeigt auf die billigere Mehltüte mit der Aufschrift Jeden-Tag. Es gehört zu den Handelsmarken – wie Back Family von Aldi oder ja! von Rewe. Das Mehl sei nicht unbedingt schlechter. Der Verbraucher wisse nur nicht, wo es herkommt. „Wir werden austauschbar.“ Es gebe keine Beziehung zwischen Hersteller und Kunde. Diese kann aber ein Schlüssel für faire Preise sein. Wer um die Sorgen des Produzenten vor Ort weiß, übernimmt möglicherweise auch die Verantwortung.

Fritzsch ist deshalb stolz auf das Kathi-Mehl mit dem Regionallabel „Ährenwort“. In der Dresdner Mühle wird einzig mitteldeutsches Getreide verarbeitet. Auf günstiges ukrainisches Getreide verzichten sie. „Das Risiko ist viel zu hoch“, so Fritzsch. Die Rückstandsanalyse könne das sofort herausfiltern. Das Mehl könne sie dann nicht als regional kennzeichnen. Eine Marke, die kein heimisches Versprechen auf der Tüte hat, kann das hingegen tun. Doch auch die Dresdner Mühle gehört zur Mühlengruppe Bindewald und Gutting, die teilweise für günstige Handelsmarken produziert.
Landwirt Pelz selbst weiß nicht, in welcher Ladentheke sein Getreide später liegt. Doch egal, wo das Mehl landet, verkaufen will es der Landwirt nur für einen guten Preis. Ewig kann er nicht warten: „Wir brauchen den Platz für die neue Ernte.“ Pelz wirkt frustriert in der dunklen Lagerhalle. Denn was bekannt ist: Von einem Euro, den Verbraucher für Nahrungsmittel ausgeben, erhält die Landwirtschaft 22,3 Cent.
Der Weizen klebt nicht genug

Es ist nicht nur der Wettbewerb mit dem Ausland und dem Handel, der Frust und das Gefühl von unfairen Regeln hervorruft. Pelz spricht auch von Überbürokratie und Desinteresse in der Politik. Es sei wie im Fußball. 80 Millionen Menschen wollen mitreden, schimpft der Landwirt, der sein Auto aufs Feld hinaus lenkt. Kleine grüne Pflänzchen blicken dort aus dem schwarzbraunen Boden. Stolz geht der Bauer über den Schlag, spricht von hochpräzisen Maschinen, die jede Pflanze individuell versorgen. Zwischen seinen Füßen wächst der neue Weizen heran, der im Mai geerntet wird. Davor spritzt er Pflanzenschutzmittel gegen Unkraut und düngt noch mal kräftig. Obwohl im Wörtchen „kräftig“ der Knackpunkt liegt.
Seit der Erneuerung der Düngeverordnung „hungern die Pflanzen“, so Pelz. Sein Acker befindet sich in einem roten Gebiet. Dort muss er auf 20 Prozent des nitrathaltigen Düngers verzichten. Der Grund: Die Europäische Union hat Deutschland verklagt, weil zu viel Nitrat im Grundwasser enthalten ist. Aus Nitrat entsteht durch chemische Prozesse Nitrit, das für Menschen, insbesondere Säuglinge, schädlich sein kann, heißt es vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Bei der Trinkwasseraufbereitung muss es teils mit hohen Kosten aus dem Grundwasser herausgefiltert werden.
Wegen des gekürzten Düngers fehle dem Weizen aber Protein, so Pelz. Es ist der Kleber, der Brot und Kuchen zusammenhält. Als gutes Mehl gilt ein Proteingehalt von mindestens 12 Prozent, bestätigt auch Fritzsch. Sie sorgt sich als Mühlenvertreterin wegen der Düngeverordnung um die aktuelle Qualität.
Der Proteingehalt des Weizens habe aber nicht nur mit der Düngung zu tun, erklärt Landwirt Jens Werner. Der Bio-Bauer ackert fünf Kilometer entfernt von Pelz in Klappendorf. Die Beschaffenheit des Bodens und die Trockenheit beeinträchtigen ihm zufolge auch die Qualität des Weizens. Durch den Klimawandel wird das Wetter extremer, was sich auf die Ernten auswirkt.
Der Biohof baut einen Bruchteil der Getreidemenge von Pelz an. Während im konventionellen Betrieb 8 bis 10 Tonnen Weizen pro Hektar anfallen, beläuft sich der Ertrag im Bio-Anbau auf die Hälfte – ein Grund, warum die Mehltüte vom Biohof Moog mehr als ein Euro teurer ist. Hinzukomme die preisintensive Bio-Zertifizierung, die jedes Jahr allein 20.000 Euro koste. Da sie als Bio-Gut auf Pflanzenschutzmittel verzichten, müssen sie zudem öfter den Boden bearbeiten. Ein Vorteil für Bodenleben und Artenvielfalt, ein Nachteil für die Lohnkasse, sagt der 39-jährige Biobauer.
Er und seine zehn Jahre jüngere Kollegin Josephine Moog wirken auf dem Feld wie ein ungleiches Paar. Er der Techniker für Landwirtschaft, sie die studierte Ökolandbäuerin verdeutlichen, dass Landwirt nicht gleich Landwirt und Biobauer nicht gleich Biobauer ist. Denn Moog kann Landwirtschaft nur in Bio mit ihrem Gewissen vereinbaren, einfach aus Nachhaltigkeitsgründen. Für ihn hingegen ist Bio die gute fachliche Praxis. Landwirt Werner würde auch in einem konventionellen Betrieb arbeiten und Bio-Praktiken anwenden. Ihm zufolge war die Lücke vor zehn Jahren zwischen den beiden Wirtschaftsweisen größer. Jetzt schaut man gegenseitig ab, redet miteinander.
Die beiden haben die Bauernproteste im Januar unterstützt, sind sie doch genauso unzufrieden mit der Bürokratie und spüren die zunehmende Macht des Supermarkts. „Der Lebensmitteleinzelhandel drückt den Preis auch bei Bio.“ Zwar muss der Bio-Bauer noch nicht auf die Börse schauen, um seinen Weizen zu verkaufen. Aber auch er sei in diesem Jahr Türklinken putzen gegangen. „Mein Limit waren 230 Euro“, sagt Werner. Am Ende hat er einen Teil des Weizens dennoch unter 200 Euro verkauft. Auch da gebe es mehr Angebot als Nachfrage.
Ob Bio, konventionell, gelb, weiß oder rot, die Mehltüte zeigt: In dem weißen Pulver stecken eine Menge bittere Noten, die sich zum Teil gegenseitig verstärken. Seien das zunehmende Wetterextreme, bürokratische Vorschriften, unfaire Spielregeln mit dem Ausland, fehlendes Verständnis füreinander, mangelnde Planungssicherheit durch die Politik und das „Festhalten am guten Alten“, nennt Landwirtin Moog. Sie wäre damit zufrieden, wenn sie auf Subventionen verzichten könnte, die Preise für Lebensmittel fair sowie realistisch wären und zuvorderst regionale Nahrungsmittel gekauft werden. „Die Menschen brauchen wieder einen Bezug zu Kartoffeln und Getreide.“