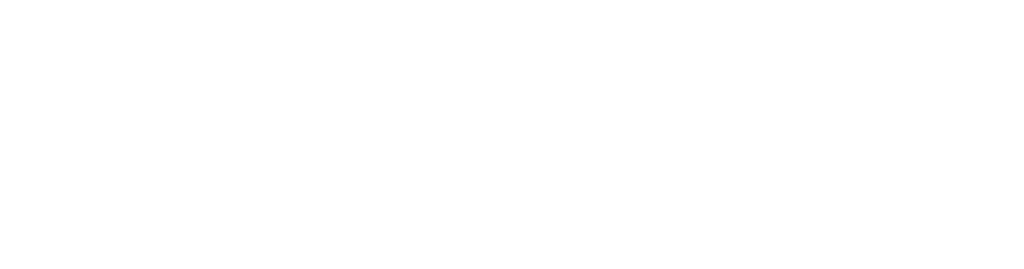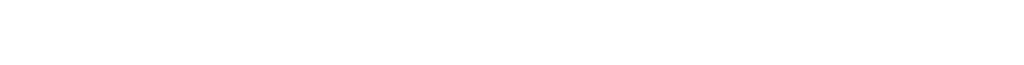Von Nora Miethke
Dresden. Die AfD gefährdet Deutschlands Zukunft“, sagt Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts für Wirtschaftsforschung. Anlass für das harte Urteil sind die Gedankenspiele von AfD-Chefin Alice Weidel zu einem EU-Austritt. Ein „Dexit“ würde laut Hüther für Deutschland das Wirtschaftswachstum um sechs Prozent reduzieren und in zehn bis 15 Jahren einen Verlust von bis zu 500 Milliarden Euro bedeuten. Das hätte gravierende Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt mit möglichen 2,2 Millionen verlorenen Jobs. Das Realexperiment Brexit gäbe für diese Prognosen die empirischen Grundlagen, so der Ökonom.
Folgen des Brexits in Großbritannien
Vor vier Jahren 2020 ist Großbritannien aus der EU ausgetreten. Die wirtschaftliche Katastrophe ist ausgeblieben, der Boom aber auch. Die Befürworter des Brexits versprachen mehr Wettbewerbsfähigkeit durch niedrigere Steuern und weniger Abgaben an die EU sowie mehr florierenden Handel durch mehr Freihandelsabkommen. Die Briten haben zwar seit dem Austritt 71 neue Handelsabkommen abgeschlossen, davon sind jedoch 68 sogenannte Roll-Over-Agreements, also Abkommen, die die Briten schon vor dem EU-Austritt hatten, sie wurden nur angepasst. Für Schlagzeilen sorgte die Aufnahme in die transpazifische Freihandelszone CPTPP, diese hat jedoch mit dem Austritt der Amerikaner 2017 an Relevanz verloren. Im Außenhandel ist fast alles beim Alten geblieben, nur das sich in Dover und Calais die LKWs stauen wegen der mühseligen Zollabfertigung.
Auch die Höhe der Steuern und Abgaben sind nach dem Brexit nicht gesunken. Das konnte sich das Vereinigte Königreich wegen der hohen Staatsverschuldung von über 108 Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt gar nicht leisten. Die britische Regierung musste die Unternehmenssteuern für Großunternehmen von 19 auf 25 Prozent erhöhen, die Insel rutschte deshalb im steuerlichen Wettbewerbsranking unter den 38 wichtigsten Ländern von 27 auf Platz 30 ab.
Folgen für Sachsen
Auch die EU ist von ihrer Historie her ein Freihandelsprojekt. Ursprünglich nur für den Güterhandel, seit Errichtung des Europäischen Binnenmarktes 1993 auch mit Freizügigkeit für Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräfte. Die Einführung des Euro 1999 als gesetzliches Zahlungsmittel hat die Wechselkursrisiken zwischen den Euro-Ländern beseitigt. All das würde aufs Spiel gesetzt, wenn Deutschland aus der EU austräte, warnt Joachim Ragnitz, Vize-Chef der Dresdner Niederlassung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. „Die Folgen wären – wenn nicht entsprechende Abkommen mit gleicher Wirkung abgeschlossen würden – für Sachsen dramatisch“, sagt er. Die Nachbarländer Tschechien und Polen sind die dritt- bzw. viertwichtigsten Exportmärkte für sächsische Unternehmen. Und aus keinem anderen Land importiert Sachsen so viele Waren wie aus Tschechien. Ein Austritt aus der EU und der Euro-Zone, wie von der AfD vorgeschlagen, würde den Handel und den grenzüberschreitenden Kapitalverkehr stark beeinträchtigen.
Auch die Freizügigkeit von Arbeitskräften könnte eingeschränkt werden, was angesichts der großen Zahl jetzt schon hier tätigen Menschen aus anderen EU-Ländern ein Problem darstellen würde, erst recht in Zukunft. Sachsen ist als alterndes Bundesland stark auf Zuwanderung angewiesen. Erinnert sei an die Folgen der Corona-Lockdowns, als die Grenzen zu Polen und Tschechien vorübergehend geschlossen wurden. Täglich pendeln rund 25.000 Menschen aus den Nachbarländern nach Sachsen.
Bürokratie lebt weiter
Natürlich könnte man durch einen Austritt den supranationalen Vorgaben für die Gesetzgebung in Deutschland entgehen. Aber im Zweifel würde man hier Regeln finden, die ähnlich sind wie in den Rest-EU-Ländern, ohne jedoch Einfluss auf die EU-Gesetzgebung nehmen zu können, meint Ragnitz.
Auch hier bietet sich ein Blick über den Ärmelkanal an. „Take back Control“ war der Schlachtruf von Brexit-Befürworter Boris Johnson, der überbordenden Regulierung aus Brüssel ein Ende setzen. Das Gegenteil passierte. Der bürokratische Aufwand für britische Unternehmen und Händler wächst. Jüngstes Beispiel: Die Hälfte all dessen, was die Briten essen, wird importiert, zu zwei Drittel aus der EU. Seit Februar gelten neue Zollregeln für Pflanzen und tierische Produkte. Ab April gibt es neue physische Lebensmittelkontrollen. Es wird mit zusätzlichen Kosten von 385 Millionen Euro pro Jahr gerechnet, Kosten die Händler in Form steigender Preise an die Verbraucher weitergeben.
In den letzten vier Jahren wurden viele EU-Regeln einfach in britisches Recht überführt und das oft strenger als nach EU-Norm notwendig wäre. Da für Großbritannien die wichtigsten Handelspartner auf dem europäischen Festland sind, mussten beide Gesetzesrahmen in Einklang gebracht werden. Dadurch nahm die Bürokratie zu, statt ab.
Weniger Fördermittel
Es sei nicht alles überzogen oder gar schädlich, was aus Europa komme, betont Ragnitz und nennt als Beispiel die EU-Beihilfenkontrolle, die ein Garant für unverzerrte Wettbewerbsbedingungen ist. Sie schränke zwar die Möglichkeiten eigenständiger Förderpolitik in Deutschland ein, aber das bewertet er aus fiskalischen Gründen als positiv, zwingt sie doch zur Disziplin bei der Zusage von Subventionen. Deutschland muss sich jede Subvention für Chipfabriken in Dresden oder andere Investitionsprojekte genehmigen lassen.
Zwar würde ein EU-Austritt dafür sorgen, dass Deutschland nicht mehr in den EU-Haushalt einzahlen müsste. Gleichzeitig könnte die EU in Deutschland keine Strukturfondsförderung mehr leisten. Gerade Sachsen hat in den vergangenen Jahrzehnten enorm davon profitiert. Allein im Zeitraum 2021 bis 2027 stehen aus den europäischen Strukturfonds für den Freistaat rund 3,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Hinzu kommen noch die 645 Millionen Euro aus dem JTF-Fonds für die Kohleregionen und die Fördermittel für europäische Wettbewerbe wie Horizon Europe oder Austauschprogramme wie Erasmus für Studierende. Ob der Bund die Ko-Finanzierung an Landesförderprogrammen dann ausgleichen würde, glaubt der Dresdner Ifo-Forscher nicht.
Die Nachteile eines „Dexit“ überwiegen. Kurzfristig wäre ein EU-Austritt ein negatives Konjunkturprogramm. „Ob sich das langfristig, wenn sich alles wieder zurechtgeruckelt hat, in irgendeiner Weise rechnet, wage ich zu bezweifeln“, sagt Ragnitz. Die Diskussion über die Fortentwicklung der EU – Erweiterung versus Vertiefung – müsse geführt werden. „Aber der Austritt selbst sollte nicht in Frage kommen“, gibt der Dresdner Ökonom zu bedenken.